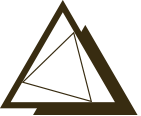Kategorie: Physiotherapie
Dreidimensionale manuelle Fußtherapie nach Zukunft-Huber – sanft, wirksam & kindgerecht
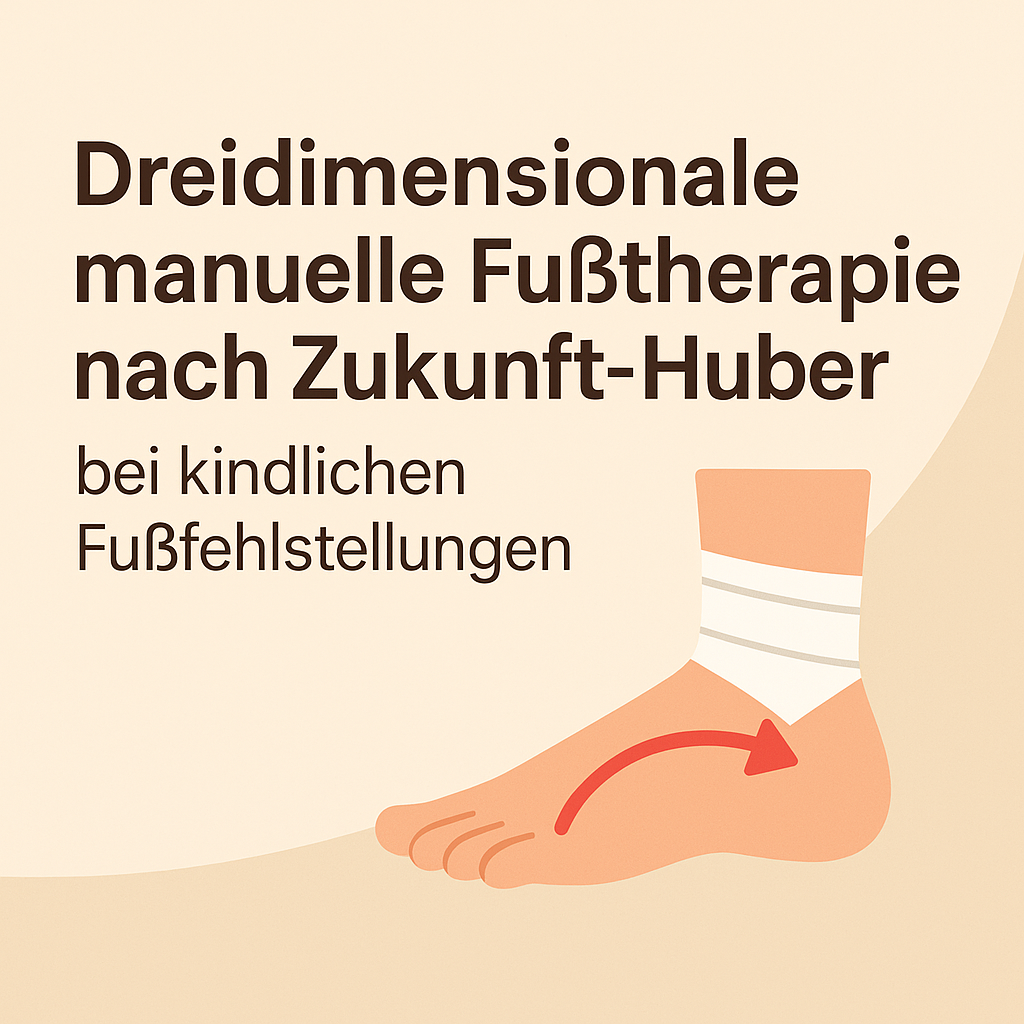
Einleitung
Immer mehr Eltern und Therapeut:innen interessieren sich für innovative, sanfte Therapieansätze bei kindlichen Fußfehlstellungen wie Knick-Senkfuß, Sichelfuß oder Klumpfuß. Die dreidimensionale manuelle Fußtherapie auf neurophysiologischer Grundlage nach Barbara Zukunft-Huber bietet eine sanfte Methode, die gezielt mit Mobilisation, Dehnung und Bandagierung arbeitet – und dabei die natürliche Entwicklung des Säuglings berücksichtigt.
Was ist diese Methode?
-
Die Methode wurde in den 1990er Jahren von Barbara Zukunft-Huber entwickelt. Universitätsmedizin Mainz+1
-
Sie orientiert sich an der physiologischen Fuß- und Beinachsenentwicklung im Säuglingsalter und nutzt spezielle Mobilisations- und Dehngriffe, um Kontraktionen von Muskeln, Faszien und Bändern zu lösen. weinheim-physiotherapie.de+3Universitätsmedizin Frankfurt+3physiotherapie-spreu.de+3
-
Im Anschluss erfolgt eine funktionelle Bandagierung, damit die erreichte Korrektur erhalten bleibt, ohne die Bewegungsfreiheit komplett einzuschränken. weinheim-physiotherapie.de+3Uniklinik Mannheim+3Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut+3
-
Die Methode kommt bei verschiedenen Fußfehlstellungen zum Einsatz: Sichelfuß, Klumpfuß, Knick-Senk-Fuß, Hackenfuß etc. weinheim-physiotherapie.de+3DAOM e. V.+3Physiotherapie Muhl & Pallokat+3
Ablauf & Therapieprinzipien
-
Befundaufnahme & Analyse
Zunächst wird der Fuß im Gesamtzusammenhang mit Beinachsen und Körperstatik untersucht, muskuläre Spannungen und Bewegungsblockaden erfasst. -
Manuelle Mobilisation & Dehnung
In dreidimensionaler Haltung werden gezielt Grifftechniken angewendet, die Weichteile dehnen, Blockaden mobilisieren und eine günstige Stellung fördern. -
Bandagierung / Fixierung
Die neue Stellung wird mit elastischen Verbänden fixiert, sodass möglichst viel Bewegungsfreiheit erhalten bleibt. Universitätsmedizin Frankfurt+3Uniklinik Mannheim+3Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut+3 -
Elternanleitung & Heimtherapie
Ein zentraler Baustein: Eltern werden in die Techniken eingewiesen, damit sie die Bandagierung & Stellungskorrektur zuhause regelmäßig unterstützen. weinheim-physiotherapie.de+3Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut+3Uniklinik Mannheim+3 -
Kontrollen & Anpassungen
Der Verlauf wird regelmäßig überwacht: Anpassung von Grifftechniken, Bandagen und ggf. Kombination mit anderen Therapien. Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut+2Universitätsmedizin Frankfurt+2
Vorteile & Einschränkungen
Vorteile
-
Keine starre Fixierung wie bei Gips: Bewegungsfreiheit bleibt weitgehend erhalten. weinheim-physiotherapie.de+3Universitätsmedizin Mainz+3Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut+3
-
Sanfte, weichteilorientierte Techniken, die sensomotorische Impulse nutzen
-
Eltern sind aktiv eingebunden – das erhöht die Kontinuität der Therapie
-
In vielen Fällen kann eine operative Maßnahme vermieden oder hinausgezögert werden
Einschränkungen / Hinweise
-
Der Erfolg hängt stark von regelmäßiger Anwendung und Mitarbeit ab (häufiges Bandagieren etc.) Uniklinik Mannheim+2Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut+2
-
In einigen Fällen sind ergänzende Maßnahmen oder Operationen dennoch notwendig
-
Therapeuten benötigen eine entsprechende Ausbildung bzw. Lizenz (die Methode ist markenrechtlich geschützt) zukunft-huber.de+2zukunft-huber.de+2
Quellen & weiterführende Lektüre
-
Unimedizin Mainz: Konzeptbeschreibung (PDF) – dreidimensionale manuelle Fußtherapie Universitätsmedizin Mainz
-
Uniklinik Mannheim: Anwendung und Therapiebeschreibung Uniklinik Mannheim
-
Zukunft-Huber: Kurse & Seminarinformationen zukunft-huber.de+1
-
DAOM: Fortbildung & Methodikbeschreibung DAOM e. V.
-
Publikation „Der kleine Fuß ganz groß“ von Zukunft-Huber zukunft-huber.de+3zukunft-huber.de+3Amazon+3
Jetzt Termin vereinbaren
Wir nehmen uns Zeit für eine umfassende Befundung und die individuelle Planung der Therapie. Vereinbare jetzt einen Termin – telefonisch oder über unser Kontaktformular.
Skoliose: frühzeitig erkennen und behandeln
Von einer Skoliose spricht man, wenn die Wirbelsäule verkrümmt und in sich verdreht ist. Besser erklärt, eine Skoliose ist eine dreidimensionale Verkrümmung der Wirbelsäule, die durch eine seitliche Abweichung von der Längsachse, eine Verdrehung (Rotation) der Wirbelkörper und häufig auch durch Veränderungen der natürlichen Wirbelsäulenkrümmungen gekennzeichnet ist.
Es handelt sich nicht nur um eine seitliche Krümmung, sondern um eine strukturelle Fehlstellung der Wirbelsäule.
Ursache der Skoliose
Die Skoliose entwickelt sich oft während des Wachstums im Kindes- und Jugendalter. Bei Mädchen tritt die Verkrümmung häufiger auf als bei Jungen. Zudem handelt es sich häufiger um eine ausgeprägtere Form als bei Jungen. Auch bei Erwachsenen sind Frauen häufiger von Skoliose betroffen als Männer.
Die genaue Ursache, warum es bei Manchen im Wachstum zur Entwicklung einer Skoliose kommt, ist nicht bekannt. Die andere häufige Form ist die Skoliose im Alter, die als Folge von Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule entsteht.
Etwa 2 Prozent aller Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren sind von einer Skoliose betroffen. Zu 75 Prozent liegt aber nur eine leichte Verkrümmung vor. 15 Prozent leiden unter einer mittleren, 5 Prozent unter einer starken und weitere 5 Prozent unter einer sehr starken Skoliose.
Formen der Skoliose
Skoliose ist nicht gleich Skoliose – je nach Ursache und Erscheinungsbild unterscheidet man verschiedene Formen. Ein Überblick:
- Idiopathische Skoliose
Die häufigste Variante: Rund 80–90 % aller Fälle fallen hierunter. Die genaue Ursache ist bis heute nicht bekannt. Besonders oft zeigt sie sich während der Pubertät, wenn der Körper schnell wächst. - Kongenitale Skoliose
Diese Form ist angeboren und entsteht durch Fehlbildungen der Wirbelkörper oder Rippen, die sich bereits im Mutterleib entwickeln. - Neuromuskuläre Skoliose
Sie entsteht als Folge von Erkrankungen der Muskeln oder des Nervensystems – etwa bei Muskeldystrophie oder Cerebralparese. - Degenerative Skoliose
Eine typische Form im Erwachsenenalter. Durch Verschleiß an Bandscheiben, Wirbelgelenken oder Osteoporose verliert die Wirbelsäule an Stabilität und beginnt sich seitlich zu verkrümmen. - Sekundäre Skoliose
Hier ist die Krümmung die Folge anderer Ursachen, zum Beispiel einer Beinlängendifferenz, Tumoren oder Verletzungen.
Neben der Ursache unterscheidet man auch die Form des Krümmungsmusters:
- C-Skoliose → eine einfache seitliche Krümmung
- S-Skoliose → zwei Krümmungen, die ein S bilden
- Doppel-S-Skoliose → mehrere Krümmungen, besonders komplex
Behandlungsmöglichkeiten bei Skoliose
Eine Skoliose kann je nach Ausprägung und Alter der Betroffenen sehr unterschiedlich verlaufen. Während leichte Formen oft kaum Beschwerden verursachen, können stärkere Krümmungen langfristig Schmerzen, Bewegungseinschränkungen oder sogar Beeinträchtigungen von Herz und Lunge mit sich bringen. Deshalb ist eine frühzeitige und individuell abgestimmte Behandlung entscheidend. Die Therapie reicht von regelmäßiger Beobachtung über physiotherapeutische Maßnahmen bis hin zu Korsettversorgung oder – in schweren Fällen – operativen Eingriffen.
Medizinische Behandlungsmöglichkeiten
- Regelmäßige Kontrolle / Beobachtung
Bei leichten Verkrümmungen wird die Skoliose zunächst nur überwacht. Besonders während des Wachstums wird regelmäßig überprüft, ob sich die Krümmung verschlimmert. - Korsetttherapie
Ein speziell angepasstes Skoliose-Korsett kann das Fortschreiten der Krümmung im Jugendalter bremsen. Es wird mehrere Stunden täglich getragen und unterstützt die Wirbelsäule in einer korrigierten Haltung. - Schmerzmedikation (bei Bedarf)
Medikamente spielen keine Rolle bei der Korrektur der Skoliose, können aber bei Schmerzen helfen, besonders im Erwachsenenalter mit degenerativer Skoliose. - Operation
Bei schweren Fällen (starke Krümmung oder schnelle Verschlechterung) kann eine operative Versteifung der Wirbelsäule notwendig werden. Metallstäbe, Schrauben oder Implantate stabilisieren die Wirbelsäule dauerhaft.
Physiotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten
- Physiotherapie nach Schroth
Eine spezielle Methode, die weltweit anerkannt ist. Durch gezielte Übungen werden Muskulatur, Haltung und Atmung so trainiert, dass die Wirbelsäule aktiv korrigiert wird. - Kräftigungs- und Dehnübungen
Bestimmte Muskelgruppen, die durch die Skoliose verkürzt oder abgeschwächt sind, werden gezielt gedehnt oder gestärkt. So entsteht ein besseres Gleichgewicht im Körper. - Atemtherapie
Da die Skoliose oft den Brustkorb verformt, verbessert eine bewusste Atemschulung die Lungenfunktion und steigert die Sauerstoffaufnahme. - Manuelle Therapie / Haltungsschulung
Physiotherapeut*innen arbeiten mit Mobilisationstechniken und geben Tipps für eine aufrechte, gesunde Haltung im Alltag. - Sportarten mit stabilisierender Wirkung
Bewegungsformen wie Schwimmen, Yoga oder Pilates stärken die Rumpfmuskulatur und fördern Beweglichkeit, ohne die Wirbelsäule einseitig zu belasten.
Die Behandlung hängt immer vom Schweregrad und Alter ab. Leichte Skoliosen können oft allein mit Physiotherapie stabilisiert werden, mittlere Verläufe erfordern meist ein Korsett, und schwere Fälle machen eine Operation notwendig.
Alltagstipps bei Skoliose
- Regelmäßige Bewegung einbauen
Langes Sitzen vermeiden – kurze Spaziergänge oder leichte Dehnübungen zwischendurch entlasten die Wirbelsäule. - Ergonomischer Arbeitsplatz
Auf eine aufrechte Sitzhaltung achten, Bildschirm auf Augenhöhe einstellen und gegebenenfalls ein ergonomisches Kissen oder eine Lordosenstütze verwenden. - Bewusstes Sitzen und Stehen
Immer wieder die Körperhaltung überprüfen – nicht ins Hohlkreuz fallen oder einseitig belasten. - Gleichmäßige Belastung im Alltag
Taschen und Rucksäcke besser beidseitig tragen, statt dauerhaft nur auf einer Schulter. - Kräftigung der Rumpfmuskulatur
Leichte Übungen für Bauch- und Rückenmuskeln regelmäßig durchführen – sie geben der Wirbelsäule Halt. - Atmung trainieren
Tiefe, bewusste Atemzüge verbessern nicht nur die Sauerstoffversorgung, sondern wirken auch entlastend auf den Brustkorb. - Sport mit Bedacht wählen
Empfehlenswert sind Schwimmen, Yoga oder Pilates. Sportarten mit starker einseitiger Belastung (z. B. Tennis, Gewichtheben ohne Anleitung) besser meiden.
Neben medizinischen und physiotherapeutischen Behandlungsformen spielt auch der Alltag eine entscheidende Rolle: Bewegung, eine gesunde Körperhaltung und gezieltes Training können helfen, Beschwerden vorzubeugen und die Wirbelsäule langfristig zu stabilisieren. Mit frühzeitiger Diagnose, konsequenter Therapie und einem bewussten Lebensstil lässt sich die Lebensqualität deutlich verbessern – und genau dabei unterstützen wir Sie in unserer Praxis.
Jetzt Termin vereinbaren
Wir nehmen uns Zeit für eine umfassende Befundung und die individuelle Planung der Therapie. Vereinbare jetzt einen Termin – telefonisch oder über unser Kontaktformular.
Schroth-Therapie bei Skoliose in Essen – Spezialisierte Physiotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Gezielte Behandlung für eine gesunde Wirbelsäule
In unserer Praxis in Essen bieten wir die Schroth-Therapie zur Behandlung von Skoliose bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an. Die Methode basiert auf einem dreidimensionalen Konzept zur Korrektur der Wirbelsäule – individuell angepasst und therapeutisch fundiert umgesetzt.
Unsere erfahrenen Therapeutinnen begleiten Patientinnen ab einem Alter von etwa 6 Jahren durch ein strukturiertes Übungsprogramm. Ziel ist es, Fehlhaltungen zu korrigieren, die Atmung zu verbessern und die eigene Körperwahrnehmung zu schulen.
Was ist die Schroth-Therapie?
Die Schroth-Therapie wurde speziell zur Behandlung von Skoliose entwickelt. Sie kombiniert:
-
Haltungsschulung
-
Atemtechniken zur Korrektur der Rumpfrotation
-
gezielte Muskelaktivierung und Stabilisierung
Im Fokus steht die dreidimensionale Aufrichtung der Wirbelsäule – individuell angepasst an Skoliose-Typ, Schweregrad, Alter und körperliche Voraussetzungen.

Für wen eignet sich die Schroth-Therapie?
-
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Skoliose
-
Frühzeitig erkannte Haltungsschäden
-
Skoliose mit oder ohne Korsett
-
Eltern, die eine fundierte, therapeutisch begleitete Unterstützung suchen
Unser Therapieansatz in Essen
-
Einzeltherapie durch zertifizierte Schroth-Therapeut*innen
-
Altersgerechte und verständlich angeleitete Übungen
-
Strukturierte Begleitung mit klaren Therapiezielen
-
Elternberatung zur Förderung des Therapieerfolgs auch im Alltag
-
Individuell abgestimmte Heimübungen für nachhaltige Wirkung
Jetzt Termin vereinbaren
Wir nehmen uns Zeit für eine umfassende Befundung und die individuelle Planung der Therapie. Vereinbare jetzt einen Termin – telefonisch oder über unser Kontaktformular.
Transkutane aurikuläre Vagusnervstimulation (taVNS) zur Verbesserung der motorischen Funktionen der oberen Extremität nach Schlaganfall
Transkutane aurikuläre Vagusnervstimulation (taVNS) zur Verbesserung der motorischen Funktionen der oberen Extremität nach Schlaganfall: Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand
Die Rehabilitation nach einem Schlaganfall stellt eine erhebliche Herausforderung dar, insbesondere wenn es um die Wiederherstellung der motorischen Funktionen der oberen Extremitäten geht. Eine vielversprechende nicht-invasive Methode, die in den letzten Jahren zunehmend an Aufmerksamkeit gewonnen hat, ist die transkutane aurikuläre Vagusnervstimulation (taVNS). Diese Methode könnte die Rehabilitationsergebnisse bei Schlaganfallpatienten verbessern und wird derzeit intensiv erforscht.
Was ist taVNS?
Die taVNS ist eine Form der Vagusnervstimulation, die über die Haut der Ohrmuschel durchgeführt wird, insbesondere durch die Stimulation des aurikulären Zweigs des Vagusnervs (ABVN) in der cymba conchae. Diese Technik bietet eine sicherere und weniger invasive Alternative zur klassischen Vagusnervstimulation (VNS), die einen chirurgischen Eingriff erfordert. Die Stimulation über taVNS zielt darauf ab, neuroplastische Prozesse im Gehirn zu fördern, was die Wiederherstellung motorischer Funktionen nach einem Schlaganfall unterstützen kann.
Forschungsergebnisse zur taVNS
Aktuelle klinische Studien haben gezeigt, dass die Kombination von taVNS mit traditionellen Rehabilitationsmethoden wie Physiotherapie signifikante Verbesserungen der motorischen Funktionen der oberen Extremitäten bei Schlaganfallpatienten bewirken kann. Die meisten dieser Studien verwenden die Fugl-Meyer Assessment Scale (FMA-U), um die Fortschritte der Patienten zu bewerten, und berichten über eine verbesserte Erholung im Vergleich zu Kontrollgruppen ohne taVNS-Behandlung.
Wichtige Erkenntnisse:
- Stimulation und Timing: Studien zeigen, dass taVNS typischerweise während oder unmittelbar nach einer Rehabilitationssitzung angewendet wird. Einige Studien kombinieren die Stimulation mit wiederholten Bewegungsübungen der oberen Extremitäten, was zu einer verstärkten motorischen Erholung führen kann.
- Sicherheitsaspekte: Obwohl taVNS im Allgemeinen gut verträglich ist, wurden in einigen Studien leichte Nebenwirkungen wie Hautrötungen, Übelkeit oder leichtes Unwohlsein berichtet. Diese Nebenwirkungen sind jedoch selten und meist mild.
- Technologische Fortschritte: Die Entwicklung von geschlossenen Rückkopplungssystemen (closed-loop systems), die taVNS in Echtzeit an die physiologischen Reaktionen des Patienten anpassen, könnte die Wirksamkeit der Behandlung weiter steigern und die Anwendung in der klinischen Praxis erleichtern.
Praktische Anwendung für Therapeuten
Für Therapeuten ergeben sich aus diesen Studien wichtige praktische Implikationen:
- Integration in bestehende Rehabilitationspläne: Die Kombination von taVNS mit herkömmlichen Rehabilitationsmethoden, insbesondere mit physiotherapeutischen Übungen, könnte die Wiederherstellung der motorischen Funktionen der Patienten beschleunigen.
- Individuelle Anpassung der Stimulation: Da die optimalen Parameter der Stimulation noch nicht vollständig erforscht sind, sollten Therapeuten die Stimulation individuell an die Bedürfnisse und die Toleranzschwelle der Patienten anpassen.
- Berücksichtigung von Nebenwirkungen: Therapeuten sollten Patienten über mögliche, aber seltene Nebenwirkungen aufklären und die Behandlung gegebenenfalls anpassen, um das Wohlbefinden der Patienten zu gewährleisten.
Fazit
Die taVNS bietet ein vielversprechendes Potenzial zur Verbesserung der motorischen Rehabilitation nach einem Schlaganfall, insbesondere in Kombination mit herkömmlichen Therapien. Zukünftige Forschungen werden erforderlich sein, um die optimalen Stimulationseinstellungen zu bestimmen und die Anwendung dieser Technik weiter zu verfeinern.
Marc Lüddecke
Praxis ThemaMensch
Eickelkamp 2
45276 Essen
Accelerometrie in der Funktionsbewertung des Gleichgewichts bei Schlaganfallpatienten
Accelerometrie in der Funktionsbewertung des Gleichgewichts bei Schlaganfallpatienten: Eine systematische Übersicht
Die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, ist für Schlaganfallpatienten von zentraler Bedeutung, da Gleichgewichtsstörungen die Lebensqualität und die funktionelle Unabhängigkeit erheblich beeinträchtigen können. Die Nutzung von Accelerometern zur Bewertung des Gleichgewichts bietet eine präzise und zugängliche Methode, die in der klinischen Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnt. Eine aktuelle systematische Übersicht analysiert die Validität und Zuverlässigkeit von Accelerometern in der funktionellen Gleichgewichtsbewertung bei Schlaganfallpatienten und gibt wertvolle Einblicke für die therapeutische Praxis.
Einsatz von Accelerometern in der Gleichgewichtsbeurteilung
Accelerometer sind elektronische Geräte, die die lineare und angulare Beschleunigung verschiedener Körpersegmente aufzeichnen. In den letzten Jahren wurden sie aufgrund ihrer Portabilität, geringen Kosten und der Fähigkeit, Bewegungen präzise zu messen, vermehrt in der Funktionsbewertung eingesetzt. Besonders triaxiale Accelerometer, die Bewegungen in drei Dimensionen erfassen können, sind in der Forschung weit verbreitet.
Validität und Zuverlässigkeit von Accelerometern
Die Übersicht umfasst acht Studien, die sowohl die Validität als auch die Zuverlässigkeit von Accelerometern in der Gleichgewichtsbewertung untersuchten. Die Ergebnisse zeigen, dass Accelerometer eine hervorragende Zuverlässigkeit bei der Messung von Gleichgewichtsparametern aufweisen. Dies bedeutet, dass die Messungen durch diese Geräte konsistent und reproduzierbar sind, was sie zu einem verlässlichen Werkzeug in der klinischen Praxis macht.
Allerdings waren die Ergebnisse hinsichtlich der Validität der Accelerometer, also ihrer Fähigkeit, das tatsächliche Gleichgewichtsniveau der Patienten präzise zu messen, uneinheitlich. Während einige Studien eine hohe Übereinstimmung mit etablierten klinischen Tests wie der Berg Balance Scale (BBS) zeigten, waren die Ergebnisse in anderen Studien weniger eindeutig.
Praktische Anwendung in der Rehabilitation
Für Therapeuten ergeben sich aus diesen Erkenntnissen mehrere wichtige praktische Implikationen:
- Verwendung in Kombination mit klinischen Skalen: Um eine umfassende Bewertung des Gleichgewichts zu erreichen, sollten Accelerometer idealerweise in Kombination mit etablierten klinischen Skalen wie dem Timed Up and Go Test (TUG) oder dem Functional Reach Test (FRT) verwendet werden. Dies kann dazu beitragen, die Genauigkeit der Bewertung zu erhöhen und die Ergebnisse für die Patientenbehandlung besser interpretierbar zu machen.
- Positionierung der Accelerometer: Die Platzierung der Accelerometer auf dem Körper kann die Messergebnisse beeinflussen. Studien zeigten, dass die Platzierung der Sensoren an der Lendenwirbelsäule (L4-L5) oder am Kreuzbein (S1-S2) am häufigsten verwendet wird und zuverlässige Ergebnisse liefert.
- Berücksichtigung der individuellen Patientenbedürfnisse: Da die Validität der Messungen variieren kann, sollten Therapeuten die individuellen Bedürfnisse und Bedingungen ihrer Patienten berücksichtigen. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Messergebnisse durch zusätzliche klinische Tests zu ergänzen.
Schlussfolgerung
Die Nutzung von Accelerometern zur funktionellen Bewertung des Gleichgewichts bei Schlaganfallpatienten bietet eine vielversprechende Methode zur Verbesserung der diagnostischen Präzision und zur Unterstützung der therapeutischen Entscheidungsfindung. Trotz einiger Uneinheitlichkeiten in den Validitätsergebnissen ist die Zuverlässigkeit dieser Geräte gut belegt, was ihre Integration in die klinische Praxis unterstützt.
Quelle: Accelerometry in the Functional Assessment of Balance in People with Stroke: A Systematic Review
Marc Lüddecke
Praxis ThemaMensch
Eickelkamp 2
45276 Essen
Lymphdrainage
Manuelle Lymphdrainage: Sanfte Technik mit großer Wirkung
Die manuelle Lymphdrainage ist eine spezielle Form der Massage, die darauf abzielt, die natürliche Funktion des Lymphsystems zu unterstützen und zu verbessern. Aber was genau ist die Lymphdrainage, und wie kann sie helfen? Lassen Sie uns in die faszinierende Welt dieser Therapieform eintauchen.
Was ist die Manuelle Lymphdrainage?
Die manuelle Lymphdrainage ist eine sanfte, rhythmische Massagetechnik, die dazu dient, überschüssige Lymphflüssigkeit aus dem Gewebe zu entfernen und den Abfluss durch das Lymphsystem zu fördern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Massagen, die auf die Muskulatur abzielen, konzentriert sich die Lymphdrainage auf die oberflächlichen Schichten der Haut.
Warum ist sie wichtig?
Das Lymphsystem spielt eine entscheidende Rolle bei der Entgiftung des Körpers und beim Immunsystem. Wenn es nicht richtig funktioniert, kann sich Flüssigkeit im Gewebe ansammeln, was zu Schwellungen, auch bekannt als Ödeme, führt.
Vorteile der Manuellen Lymphdrainage
- Reduzierung von Schwellungen: Die Lymphdrainage kann helfen, Ödeme und Schwellungen nach Verletzungen oder Operationen zu reduzieren.
- Entgiftung: Sie unterstützt den Körper bei der Entfernung von Abfallprodukten und Toxinen.
- Entspannung: Die sanfte Technik kann entspannend wirken und Stress abbauen.
- Förderung der Wundheilung: Durch die Reduzierung von Schwellungen kann die Lymphdrainage die Heilung von Wunden und Narben unterstützen.
Wann wird sie angewendet?
Die manuelle Lymphdrainage wird in einer Vielzahl von Situationen empfohlen, darunter:
- Nach Operationen, insbesondere nach plastischer Chirurgie
- Bei Lymphödemen, die durch Krebsbehandlungen verursacht werden
- Bei Sportverletzungen
- Zur allgemeinen Entspannung und Entgiftung
Fazit
Die manuelle Lymphdrainage ist eine kraftvolle, aber dennoch sanfte Technik, die eine Vielzahl von gesundheitlichen Vorteilen bietet. Von der Reduzierung von Schwellungen bis zur Unterstützung des Immunsystems kann diese Therapieform dazu beitragen, das Wohlbefinden und die Gesundheit zu fördern. Wenn Sie glauben, dass die manuelle Lymphdrainage Ihnen helfen könnte, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten.
Krankengymnastik
Krankengymnastik: Mehr als nur Bewegung
Krankengymnastik, oft auch als Physiotherapie bezeichnet, ist eine therapeutische Methode, die darauf abzielt, Schmerzen zu lindern, die Funktion wiederherzustellen und die Beweglichkeit zu verbessern. Aber was genau ist Krankengymnastik und wie kann sie helfen? Tauchen Sie mit uns in die Welt der Krankengymnastik ein.
Was ist Krankengymnastik?
Krankengymnastik ist eine Form der physischen Therapie, die eine Kombination aus manuellen Techniken, Übungen und verschiedenen physikalischen Mitteln (wie Wärme oder Kälte) verwendet, um körperliche Beschwerden zu behandeln. Sie kann bei einer Vielzahl von Erkrankungen und Verletzungen helfen, von Rückenschmerzen bis hin zu postoperativen Rehabilitationen.
Die Vorteile der Krankengymnastik
- Schmerzlinderung: Durch gezielte Übungen und manuelle Techniken kann die Krankengymnastik helfen, Schmerzen zu reduzieren oder sogar zu eliminieren.
- Verbesserung der Mobilität: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich zu bewegen, zu gehen oder zu stehen – egal wie alt Sie sind – kann Krankengymnastik helfen.
- Verletzungsprävention: Durch das Erkennen von Bewegungsmustern, die zu Verletzungen führen können, kann ein Physiotherapeut individuelle Strategien und Programme entwickeln, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
- Verbesserung der Balance: Krankengymnastik kann auch dazu beitragen, das Gleichgewicht zu verbessern und das Risiko von Stürzen zu reduzieren.
Wann sollte man Krankengymnastik in Erwägung ziehen?
Es gibt viele Gründe, warum jemand eine Krankengymnastik in Anspruch nehmen könnte, darunter:
- Chronische Schmerzen
- Verletzungen oder Erkrankungen des Bewegungsapparates
- Vor oder nach Operationen
- Neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall oder Multiple Sklerose
- Herz- und Lungenprobleme
- Und viele mehr
Fazit
Krankengymnastik ist eine vielseitige Therapieform, die Menschen jeden Alters helfen kann, ein aktiveres und schmerzfreieres Leben zu führen. Wenn Sie glauben, dass Krankengymnastik Ihnen helfen könnte, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder suchen Sie einen qualifizierten Physiotherapeuten in Ihrer Nähe.
Neurologische Behandlung nach dem Bobath-Konzept
Was ist das?
Das Bobath-Konzept entwickelt von Berta Bobath und ihrem Mann Dr. Karel Bobath wird für die Befundung und Behandlung von Patienten mit neurologischen Defiziten angewandt.
Es ist so ruhig hier
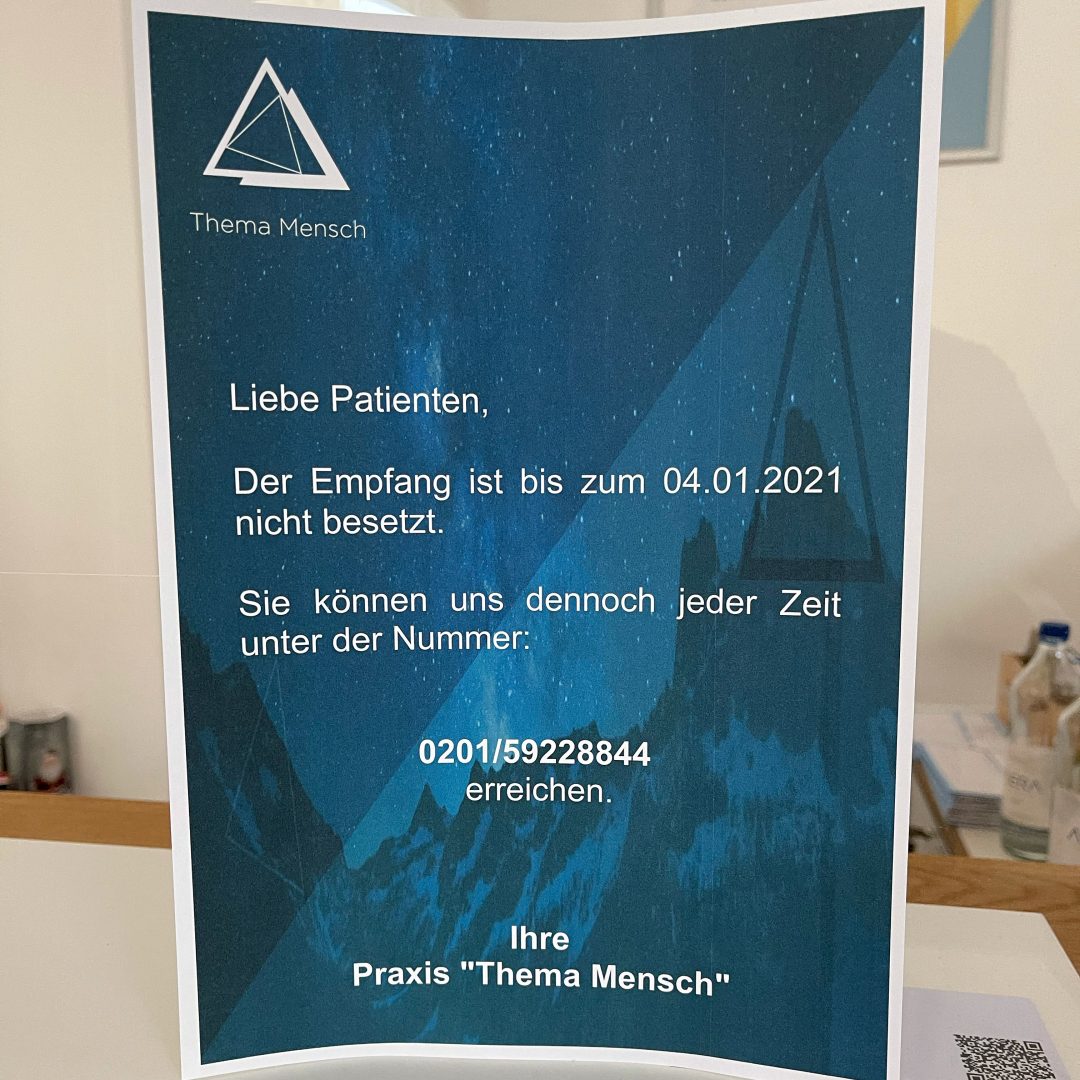
Liebe Patienten,
unser Empfang ist bis zum 4. Januar im wohlverdienten Urlaub. Wir sind selbstverständlich weiterhin für Sie da. Allerdings kann ein Rückruf momentan etwas dauern.Wir bitten dies zu entschuldigen und wünschen frohe Festtage, einen guten Rutsch und bleiben Sie gesund.
Alles fertig und bereit…

Alle Räume sind endlich nutzbar für die Therapie

Wir haben es geschafft, alle Räume sind in Betrieb und ausgestattet mit allem was das Physioherz begehrt.
Wir haben eine Seite erstellt, auf der sich die Patienten die Räume genau angucken können.
Dafür klicken Sie bitten hier.
Bleiben Sie gesund
Praxis Themamensch