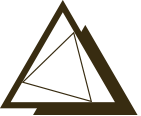Schlagwort: PNF
Risikofaktoren Schlaganfall
Was sind die Risikofaktoren für einen Schlaganfall?
Ein Schlaganfall kann jeden treffen, aber bestimmte Faktoren erhöhen das Risiko erheblich. Einige dieser Risikofaktoren können kontrolliert werden, während andere nicht beeinflussbar sind. Es ist wichtig, diese Risiken zu kennen, um präventive Maßnahmen ergreifen zu können.
Nicht beeinflussbare Risikofaktoren:
- Alter: Mit zunehmendem Alter steigt das Schlaganfallrisiko, insbesondere nach dem 55. Lebensjahr.
- Geschlecht: Männer haben ein höheres Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, während Frauen tendenziell schwerere Verläufe haben.
- Familiäre Vorbelastung: Ein erhöhtes Risiko besteht, wenn nahe Verwandte bereits einen Schlaganfall erlitten haben.
Beeinflussbare Risikofaktoren:
- Bluthochdruck (Hypertonie): Der wichtigste beeinflussbare Risikofaktor. Ein dauerhaft erhöhter Blutdruck schädigt die Blutgefäße und kann zu einem Schlaganfall führen.
- Rauchen: Tabakkonsum verdoppelt das Schlaganfallrisiko, da es die Blutgefäße verengt und die Gerinnung fördert.
- Diabetes: Ein schlecht eingestellter Blutzuckerspiegel erhöht das Schlaganfallrisiko erheblich, da Diabetes die Blutgefäße schädigt.
- Übergewicht und Bewegungsmangel: Diese Faktoren erhöhen das Risiko für Bluthochdruck, Diabetes und andere Gesundheitsprobleme, die zu einem Schlaganfall führen können.
- Herzkrankheiten: Vorhofflimmern und andere Herzrhythmusstörungen erhöhen das Risiko, dass sich Blutgerinnsel bilden, die ins Gehirn wandern können.
Was können Sie tun, um Ihr Risiko zu senken?
Es gibt viele Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um Ihr Schlaganfallrisiko zu reduzieren. Dazu gehören eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, Rauchstopp und die regelmäßige Kontrolle von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin.
Praxis ThemaMensch
Eickelkamp 2
45276 Essen
Aktuelle Trends in der Gleichgewichtsrehabilitation Schlaganfallbetroffene
Aktuelle Trends in der Gleichgewichtsrehabilitation für Schlaganfallüberlebende: Eine Übersicht
Gleichgewichtsstörungen sind eine der häufigsten und herausforderndsten Folgen eines Schlaganfalls, die die Lebensqualität und die funktionelle Unabhängigkeit der Betroffenen erheblich beeinträchtigen können. Die jüngste Scoping-Übersicht bietet einen umfassenden Überblick über die neuesten Trends in der Gleichgewichtsrehabilitation bei Schlaganfallpatienten und fasst die Ergebnisse von 14 experimentellen Studien zusammen, die verschiedene innovative und traditionelle Ansätze untersuchten.
Überblick über die rehabilitativen Ansätze
In der Übersicht wurden sieben Hauptkategorien von Gleichgewichtsinterventionen identifiziert:
- Konventionelle Rehabilitationsübungen: Diese umfassen selektive Rumpfmuskelübungen und Übungen zur Mobilisierung der betroffenen Extremitäten. Studien zeigen, dass solche Übungen die Rumpfkontrolle, das Gleichgewicht und die Mobilität signifikant verbessern können, insbesondere wenn sie in Kombination mit traditionellen Rehabilitationsmethoden wie Muskelkräftigung und Aufgabenorientierung eingesetzt werden.
- Gym-basierte Interventionen: Übungen, die auf Core-Training mit einem Swiss Ball oder auf geschlossene und offene kinetische Kettenübungen fokussieren, haben sich als wirksam erwiesen, um die Muskelaktivierung und das Gleichgewicht zu verbessern. Rückwärtsgehen auf einem Laufband war eine weitere vielversprechende Methode, die positive Auswirkungen auf das Gleichgewicht und die kardiopulmonale Fitness hatte.
- Vibrationstherapie: Studien zeigen, dass Ganzkörpervibrationstherapie die Wiederherstellung des Gleichgewichts bei Schlaganfallpatienten unterstützen kann. Diese Methode wurde als Ergänzung zu konventionellen Therapien eingesetzt und zeigte funktionelle Verbesserungen, insbesondere in der Sitzbalance und den Alltagsaktivitäten.
- Rhythmische auditive Stimulation: Diese Methode nutzt Musik und Metronome, um die Gehfähigkeit und das Gleichgewicht zu verbessern. Patienten synchronisierten ihre Bewegungen mit den rhythmischen Signalen, was zu einer signifikanten Verbesserung der Gehleistung führte.
- Boxtherapie: Sowohl virtuelle als auch reale Boxtrainingsprogramme zeigten positive Effekte auf die Gleichgewichtsfunktion und die kognitive Leistung. Diese innovative Therapieform kombiniert körperliches Training mit kognitiven Aufgaben und fördert so die ganzheitliche Rehabilitation.
- Technologie-basierte Interventionen: Der Einsatz von Virtual-Reality-Systemen und robotergestützten Trainingsgeräten zeigte vielversprechende Ergebnisse bei der Verbesserung der Rumpfkontrolle und des Gleichgewichts. Diese Technologien bieten Patienten eine motivierende und interaktive Umgebung, die das Engagement und die Teilnahme an der Rehabilitation fördert.
- Dual-Task-Training: Das gleichzeitige Training von motorischen und kognitiven Aufgaben, entweder an Land oder im Wasser, erwies sich als wirksam zur Verbesserung von Gleichgewicht und Gang. Diese Methode ahmt reale Herausforderungen nach und fördert die Anpassung an alltägliche Aktivitäten.
Praktische Empfehlungen für Therapeuten
Die in der Übersicht vorgestellten Interventionen bieten Therapeuten eine Vielzahl von Ansätzen, um die Gleichgewichtsrehabilitation individuell an die Bedürfnisse der Patienten anzupassen:
- Individuelle Anpassung der Therapie: Jede der genannten Methoden kann je nach spezifischen Bedürfnissen des Patienten angepasst werden. Es ist wichtig, die richtige Kombination von Übungen und Technologien auszuwählen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Integration von Technologie: Der Einsatz von Virtual-Reality und robotergestütztem Training kann die Rehabilitationsprogramme bereichern und die Motivation der Patienten erhöhen. Diese Technologien bieten zusätzliche Möglichkeiten zur Messung und Anpassung des Trainings in Echtzeit.
- Dual-Task-Ansätze: Diese sind besonders hilfreich für Patienten, die sowohl motorische als auch kognitive Herausforderungen bewältigen müssen. Die Integration dieser Trainingsmethoden in die Rehabilitationsprogramme kann die funktionelle Erholung beschleunigen.
Fazit
Die aktuellen Trends in der Gleichgewichtsrehabilitation bei Schlaganfallüberlebenden zeigen, dass eine Kombination aus traditionellen und innovativen Ansätzen die besten Ergebnisse liefern kann. Therapeuten sollten die individuellen Bedürfnisse ihrer Patienten berücksichtigen und eine Vielzahl von Methoden in ihre Programme integrieren, um die funktionelle Unabhängigkeit und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.
Marc Lüddecke
Praxis ThemaMensch
Eickelkamp 2
45276 Essen
Accelerometrie in der Funktionsbewertung des Gleichgewichts bei Schlaganfallpatienten
Accelerometrie in der Funktionsbewertung des Gleichgewichts bei Schlaganfallpatienten: Eine systematische Übersicht
Die Fähigkeit, das Gleichgewicht zu halten, ist für Schlaganfallpatienten von zentraler Bedeutung, da Gleichgewichtsstörungen die Lebensqualität und die funktionelle Unabhängigkeit erheblich beeinträchtigen können. Die Nutzung von Accelerometern zur Bewertung des Gleichgewichts bietet eine präzise und zugängliche Methode, die in der klinischen Praxis zunehmend an Bedeutung gewinnt. Eine aktuelle systematische Übersicht analysiert die Validität und Zuverlässigkeit von Accelerometern in der funktionellen Gleichgewichtsbewertung bei Schlaganfallpatienten und gibt wertvolle Einblicke für die therapeutische Praxis.
Einsatz von Accelerometern in der Gleichgewichtsbeurteilung
Accelerometer sind elektronische Geräte, die die lineare und angulare Beschleunigung verschiedener Körpersegmente aufzeichnen. In den letzten Jahren wurden sie aufgrund ihrer Portabilität, geringen Kosten und der Fähigkeit, Bewegungen präzise zu messen, vermehrt in der Funktionsbewertung eingesetzt. Besonders triaxiale Accelerometer, die Bewegungen in drei Dimensionen erfassen können, sind in der Forschung weit verbreitet.
Validität und Zuverlässigkeit von Accelerometern
Die Übersicht umfasst acht Studien, die sowohl die Validität als auch die Zuverlässigkeit von Accelerometern in der Gleichgewichtsbewertung untersuchten. Die Ergebnisse zeigen, dass Accelerometer eine hervorragende Zuverlässigkeit bei der Messung von Gleichgewichtsparametern aufweisen. Dies bedeutet, dass die Messungen durch diese Geräte konsistent und reproduzierbar sind, was sie zu einem verlässlichen Werkzeug in der klinischen Praxis macht.
Allerdings waren die Ergebnisse hinsichtlich der Validität der Accelerometer, also ihrer Fähigkeit, das tatsächliche Gleichgewichtsniveau der Patienten präzise zu messen, uneinheitlich. Während einige Studien eine hohe Übereinstimmung mit etablierten klinischen Tests wie der Berg Balance Scale (BBS) zeigten, waren die Ergebnisse in anderen Studien weniger eindeutig.
Praktische Anwendung in der Rehabilitation
Für Therapeuten ergeben sich aus diesen Erkenntnissen mehrere wichtige praktische Implikationen:
- Verwendung in Kombination mit klinischen Skalen: Um eine umfassende Bewertung des Gleichgewichts zu erreichen, sollten Accelerometer idealerweise in Kombination mit etablierten klinischen Skalen wie dem Timed Up and Go Test (TUG) oder dem Functional Reach Test (FRT) verwendet werden. Dies kann dazu beitragen, die Genauigkeit der Bewertung zu erhöhen und die Ergebnisse für die Patientenbehandlung besser interpretierbar zu machen.
- Positionierung der Accelerometer: Die Platzierung der Accelerometer auf dem Körper kann die Messergebnisse beeinflussen. Studien zeigten, dass die Platzierung der Sensoren an der Lendenwirbelsäule (L4-L5) oder am Kreuzbein (S1-S2) am häufigsten verwendet wird und zuverlässige Ergebnisse liefert.
- Berücksichtigung der individuellen Patientenbedürfnisse: Da die Validität der Messungen variieren kann, sollten Therapeuten die individuellen Bedürfnisse und Bedingungen ihrer Patienten berücksichtigen. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, die Messergebnisse durch zusätzliche klinische Tests zu ergänzen.
Schlussfolgerung
Die Nutzung von Accelerometern zur funktionellen Bewertung des Gleichgewichts bei Schlaganfallpatienten bietet eine vielversprechende Methode zur Verbesserung der diagnostischen Präzision und zur Unterstützung der therapeutischen Entscheidungsfindung. Trotz einiger Uneinheitlichkeiten in den Validitätsergebnissen ist die Zuverlässigkeit dieser Geräte gut belegt, was ihre Integration in die klinische Praxis unterstützt.
Quelle: Accelerometry in the Functional Assessment of Balance in People with Stroke: A Systematic Review
Marc Lüddecke
Praxis ThemaMensch
Eickelkamp 2
45276 Essen
Vibrationstherapie bei post-Schlaganfall-Spastizität
Vibrationstherapie bei post-Schlaganfall-Spastizität: Effekte und praktische Anwendung
Die Vibrationstherapie (VT) gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Behandlung von post-Schlaganfall-Spastizität (PSS). Eine systematische Übersicht und Meta-Analyse randomisierter kontrollierter Studien zeigt vielversprechende Ergebnisse bezüglich der Wirksamkeit von VT bei der Reduktion von Spastizität und Schmerz sowie der Verbesserung motorischer Funktionen bei Patienten mit PSS.
Effekte der Vibrationstherapie
Die Meta-Analyse ergab, dass VT signifikant zur Reduktion der Spastizität beiträgt. Dies gilt sowohl für lokale Muskelvibration (LMV) als auch für Ganzkörpervibration (WBV). Besonders effektiv zeigte sich VT in der Reduktion der Spastizität in den oberen Extremitäten, insbesondere in Schulter und Ellbogen. Für die unteren Extremitäten, wie Knie und Knöchel, konnte keine signifikante Reduktion der Spastizität festgestellt werden. Ebenso bleibt die Wirkung von VT auf die Gangperformance unklar.
Zusätzlich zeigte sich, dass VT auch zur Schmerzlinderung bei PSS-Patienten beitragen kann. Die Verbesserung der motorischen Funktionen war ebenfalls signifikant, was darauf hindeutet, dass VT nicht nur die Spastizität reduziert, sondern auch die funktionelle Erholung unterstützt.
Praktische Anwendung und Parameter
Bei der Anwendung von VT sollten verschiedene Parameter berücksichtigt werden:
- Vibrationstyp: Sowohl LMV als auch WBV sind wirksam, wobei LMV möglicherweise eine etwas stärkere Wirkung zeigt, da sie gezielt auf spezifische Muskelgruppen wirkt.
- Frequenz: Eine Frequenz von über 20 Hz erwies sich als effektiver bei der Reduktion der Spastizität als niedrigere Frequenzen.
- Dauer: Sitzungen von 30 Minuten zeigten die besten Ergebnisse, während kürzere Sitzungen weniger effektiv waren.
- Sitzungshäufigkeit: Die besten Ergebnisse wurden bei Sitzungen drei- bis fünfmal pro Woche erzielt, wobei kein signifikanter Unterschied zwischen diesen Frequenzen festgestellt wurde.
Schlussfolgerung
Die Ergebnisse der Meta-Analyse zeigen, dass VT eine wertvolle Ergänzung zur Behandlung von PSS sein kann, insbesondere bei der Reduktion von Spastizität und Schmerz sowie der Verbesserung der motorischen Funktion. In der klinischen Praxis sollten Therapeuten die individuellen Bedürfnisse und den funktionellen Status der Patienten berücksichtigen, um die optimalen VT-Parameter festzulegen.
Marc Lüddecke
Praxis ThemaMensch
Eickelkamp 2
45276 Essen
Welt MS Tag.

Am 30.Mai findet eine Veranstaltung im Krupp Krankenhaus Rüttenscheid zum Thema Multiple Sklerose statt und es wird einige interessante Vorträge und Austauschmöglichkeiten geben. Es lohnt sich also dabei zu sein, egal ob Betroffen, Angehörige oder Therapeuten.
Die Physiotherapeuten der Praxis Thema Mensch sind dabei, um immer auf dem neusten stand zu bleiben.

Physiotherapie ist ein wichtiger Bestandteil der symptomatischen und präventiven Therapie der MS, sollten Sie am 30. Mai nicht dabei sein können, Informieren wir Sie gerne über die Möglichkeiten.
Ihre Praxis Thema Mensch
Neurologische Behandlung nach PNF Konzept

Propriozeptiv, Propriozeption:
Damit der Mensch seine Bewegungen organisieren und harmonisieren kann, bedarf es der Fähigkeit der Körperwahrnehmung. Diese wird gewährleistet, durch viele Rezeptoren die sich vorangig in Muskeln, Gelenken und Sehen befinden. Sie ermitteln beispielsweise die Stellung der Knochen zueinander. Sie wissen beispielsweise ob Ihr Ellenbogen gestreckt oder gebeugt ist, selbst wenn Sie nicht hinsehen, das nennt man Propriozeption(Wahrnehmung). Bei vielen neurologischen Erkrankungen ist diese Wahrnehmung gestört und führt somit zu einigen Problemen im Bewegungsablauf.
In der PNF Behandlung wird das Zusammenspiel eben dieser Rezeptoren und den dazugehörigen Nerven und Muskeln gefördert daher Neuromuskulär. Das so verbesserte Zusammenspiel soll dem Patienten die Bewegungen des Alltags erleichtern also Fazilitieren (aus dem lat.).
Das macht den Unterschied: Um die natürlichen Bewegungsabläufe nachzuahmen, bedient sich das PNF Konzept 3 dimensionalen Bewegungen in speziellen Drehungen und Rotationen entsprechend den Muskelverläufen. Entgegengesetzt zu den herkömmlichen Trainingsmethoden welche meist den Muskel in 2 Dimensionalen Bewegungen in nur einer Achse Trainieren.
PNF ist Konzept, Therapiemethode und Technik zugleich.
Dabei ist besonders hervorzuheben, dass PNF sich an den Ressourcen des Patienten orientiert und diese gezielt zur Verbesserung der Bewegungs- und Haltungskontrolle einsetzt. D.h., dass zur Verfügung stehende Fähigkeiten von besonderem Interesse sind. Machen Sie folgendes kleines Experiment: „drücken Sie Ihre Hand kräftig auf den Tisch, vor dem Sie gerade sitzen“. Sie werden sogleich merken, dass Ihre Bauchmuskeln zu arbeiten beginnen. So kann ein kräftiger Arm genutzt werden, um schwache Bauchmuskeln zu aktivieren.
Einsatzgebiete: PNF kann Menschen mit Störungen des Bewegungs- oder Stützapparates helfen, ihre Sicherheit und Selbständigkeit zu verbessern und Schmerzen zu beheben oder zu lindern. Eine Behandlung nach PNF wird insbesondere angewandt bei Bewegungsstörungen aufgrund von:
- Multipler Sklerose
- Morbus Parkinson
- Querschnittslähmung
- Schädel-Hirn-Trauma
- Schlaganfall
- Gelenkoperationen
- Sportunfällen
- Gesicht-, Mund- und Schluckbeschwerden (inklusive Kieferproblematiken)
- Rückenschmerz
Die Therapie verbessert die bewusste und unbewusste Steuerung der Körperhaltung und Bewegung. Bei schweren Erkrankungen oder Verletzungen fördert PNF lebenserhaltende Funktionen wie die Atmung, das Essen und das Schlucken.
PNF darf nur von speziell Ausgebildeten Therapeuten durchgeführt werden.